Die wichtigsten Inhalte des Textes von Roland Barthes werden an dieser Stelle kurz präsentiert und zum Abschluss in Bezug zur Erörterung aus der Eröffnungssitzung des Seminars gesetzt.
In seinem Aufsatz zur Strukturalistischen Tätigkeit versucht Roland Barthes eine Klassifikation des Schöpfungsprozesses der Künstler vorzunehmen die allgemein dem sogenannten Strukturalismus zugeordnet werden. Die Zuordnung eines Künstlers zum Strukturalismus empfindet Barthes zunächst als insofern promblematisch, dass keiner dieser Künstler sich selbst einer Strömung namens Strukturalismus zuordne. Außerdem gebe es keine Bewegung die sich Strukturalismus nennt, weshalb man dahin zurückkehren muss, die Tätigkeit dieser „strukturalen Menschen“ so nah wie es nur geht zu beschreiben. Aus seiner Argumentation heraus ergeben sich folgende wichtige Definitionen:
- Strukturaler Mensch: gibt dem Objekt durch hinzufügen seines Intellekts eine Bedeutung
- Strukturalistische Tätigkeit: Rekonstruktion eines Objektes in dem Maße, das die Funktionen dieses Objekts sichtbar werden. Das „imitierte“ Objekt bringt dabei etwas zum Vorschein, das im natürlichen Objekt unsichtbar ist.
- Simulacrum: Rekonstruktion eines Objekts durch Zerlegung und Neuarrangement
Die Arbeit des Künstlers besteht also darin ein Objekt mithilfe seines Intellekts nachzuahmen und ihm eine neue Bedeutung zu geben. Die zwei typischen Operationen der strukturalistischen Tätigkeit definiert Barthes als Zerlegung und Arrangement.
Hat der Künstler ein Objekt in seine Einzelteile zerlegt, so tragen die einzelnen Fragmente keine Bedeutung, die Unterschiede zwischen diesen Fragmente. Schließen sich jedoch zu einer Gesamtbedeutung zusammen. Verändert man dann eines der Fragmente, ändert sich auch die Gesamtbedeutung. Alle Einheiten eines Objekts die in ihrer Verschiedenartigkeit zur Gesamtbedeutung des Objekts beitragen, bestimmen es auch insofern, dass sie sich von anderen Einheiten, mit denen sie eine Klasse bilden, abgrenzt. Mit dieser Bestimmung zieht Barthes die Parallele zur Linguistik und fügt den Begriff des Paradigmas an. „Das paradigmatische Objekt wird dadurch charakterisiert, daß es zu den anderen Objekten seiner Klasse in einer bestimmten Beziehung der Affinität und Verschiedenartigkeit steht: zwei Einheiten eines Paradigmas müssen sich in einigem gleichen, damit sie Verschiedenartigkeit, die sie trennt, Evidenz gewinnen kann.“
Der Akt des Arrangements ist dann bestimmten Regeln unterworfen. Barthes bezeichnet diesen „Regelzwang“ als eine Art Kampf gegen den Zufall. Denn „durch die regelmäßige Wiederkehr der Einheiten und Assoziationen von Einheiten kommt das Werk als konstruiertes zum Vorschein, das heißt mit Bedeutung versehen; die Linguisten nennen diese Kombinationsregeln Formen.“ Daraus ergibt sich für Barthes, dass bei der Erschaffung eines Objekts unter Einhaltung der Kombinationsregeln, der strukturale Mensch versucht, das Kunstwerk dem Zufall zu entreißen.
Nun ist nach der Zerlegung in seine Einzelteile und dem Arrangement nach bestimmten Kombinationsregeln aus dem Objekt ein Simulacrum entstanden. Dabei spiegelt das Simulacrum in keiner Weise die Welt wieder, die es aufgegriffen hat. In dieser Tatsache liegt für Barthes die Grundbedeutung des Strukturalismus. Es entsteht eine neue Kategorie für ein Objekt, die weder das Reale noch das Rationelle aufzeigt, sondern für das Funktionelle steht. Die Aufgabe des strukturalen Menschen besteht also nicht darin einem Objekt Bedeutung zuzuweisen, sondern erst der Akt der Bedeutungsschöpfung durch den Menschen steht im Zentrum des Strukturalismus. Barthes definiert diesen Menschen als homo significans.
Daraus ergeben sich folgende wichtige Schlüsse für das Schaffen des Strukturalismus.
- Das Ziel des strukturalen Menschen ist es stetig an der Schöpfung von Bedeutungen zu arbeiten. Daraus ergibt sich:
- „Und weil dieses Herstelltlen von Bedeutung selbst, weil die Funktion weiter reicht als die Werke, macht sich der Strukturalismus zur Tätigkeit und stellt die Erschaffung des Werks und das Werk selber in ein und dieselbe Identität.“
Zur Kritik am strukturalen Menschen irrational zu sein äußert sich Barthes selbst kritisch. Denn der Denn Strukturalismus ist nicht nur aktiv, sondern auch passiv. Er bindet nicht nur an Inhalte und Formen, sondern auch an intelligible Aspekte. So würde der Strukturalismus keine alte Sprache wiederbeleben und seine Aufgabe als beendet ansehen wenn eine neu entstehende Sprache strukturalistisch spreche.
Für das Seminar Semiotik und Popkultur ist meiner Meinung nach vor allem der Begriff des Simulacrums hervorzuheben. Wenn wir uns noch einmal das Bild aus der Eröffnungssitzung betrachten, dann lassen sich einige Aussagen von Barthes darauf anwenden.
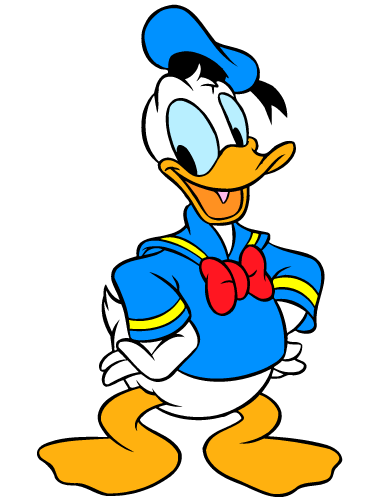
Der Schöpfer dieser Comicfigur hat sich am realen Objekt der „Ente“ bedient, um aus ihr ein neues Objekt mit einer neuen Bedeutung zu erschaffen. Die äußere Form der Ente ist noch klar erkennbar, allerdings wurden ihr neue Einheiten zugeschrieben, die nicht einer echten Ente entsprechen: sie läuft aufrecht und trägt ganz offensichtlich von Menschen gemachte Kleidung. Auch der Name ist eine Zweiteilung aus Beziehung zum Ursprungsobjekt („Duck“) und einem menschlichen Begriff, hier einem menschlichen Vornamen („Donald“). Hier sind auch die oben erläuterten Bedingungen des Paradigmas erfüllt. Die Bezeichnung „duck“ und einige äußere Eigenschaften wie der Schnabel und die Federn stellen den Bezug zum Tierreich her. Die Eigenschaft des Sprechens und der Kleidung trennt das Objekt jedoch von dieser Klasse.
Textliche Grundlage:
Roland Barthes: „Die strukturalistische Tätigkeit“, In: Dorothee Kimmich, Rolf Günter Renner und Bernd Stiegler [Hrsg.]. Texte zur Literaturtheorie der Gegenwart. Stuttgart, 1996. S. 215 – 223.